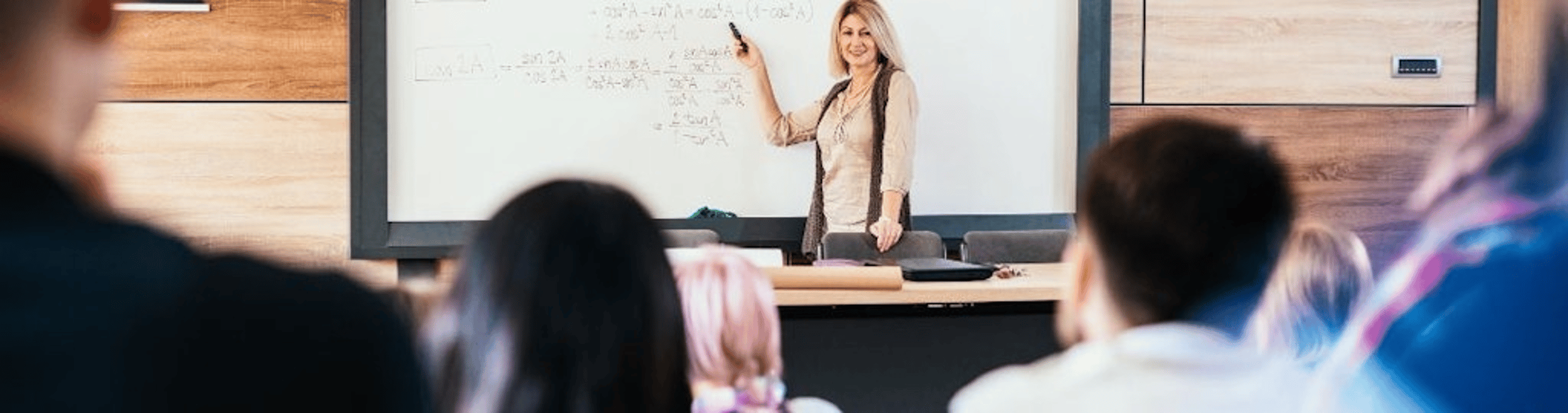Ein Studium der Sprachen - egal für welche Sprache du dich entscheidest - ist eine spannende Wahl für alle, die sich für Sprachwissenschaft, Literatur, Kulturen und Kommunikation begeistern. Im Studium erwirbt man fundierte Kenntnisse über die Struktur und Entwicklung der Sprache sowie über literarische und kulturelle Aspekte. Das Studium bietet in der Regel eine breite Palette an Fachrichtungen wie Sprachwissenschaft, Übersetzung, Dolmetschen oder Fremdsprachenphilologie. AbsolventInnen haben vielfältige Karrieremöglichkeiten in den Bereichen Übersetzung, Dolmetschen, Sprachunterricht, Medien, Tourismus und mehr. Das Studium fördert nicht nur Sprachkompetenz, sondern auch interkulturelles Verständnis und analytische Fähigkeiten. Es öffnet Türen zu globalen Berufsfeldern und ermöglicht eine faszinierende Reise durch Sprache und Kultur.